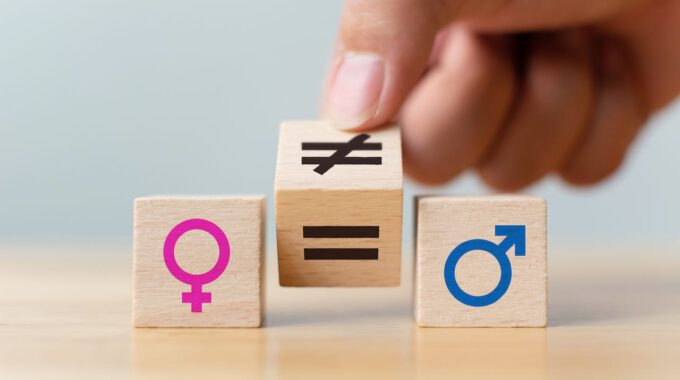VON NORA-HENRIETTE FRIEDEL UND MARLEEN HOFFMANN
erschienen in: Chorzeit, Das Vokalmagazin, Nr. 66, Dezember 2019
Vor einem Jahr begann eine öffentliche Debatte um renommierte Knabenchöre und Gleichstellung, die die Chorszene nachhaltig beschäftigt: Die Berliner Rechtsanwältin Susann Bräcklein hatte im Tagesspiegel geschrieben, dass der generelle Ausschluss von Mädchen eine verfassungswidrige Diskriminierung sei. Dabei dachte sie vor allem an Chöre, die in staatlicher Trägerschaft eine herausragende musikalische Ausbildung anbieten. «Eine Ausbildung, die sich auch Eltern für ihre Töchter wünschen», erklärt die Juristin und Mutter eines Mädchens. So wirbt etwa der Berliner Staats- und Domchor, dessen Träger die Universität der Künste (UdK) ist, mit einer kostenfreien Ausbildung, was Bräcklein umso mehr geärgert habe, als ihre siebenjährige Tochter ihr den Flyer des über 550 Jahre alten Knabenchores in die Hand drückte. Schon 2016 meldete sie das Mädchen für den Staats- und Domchor an – vergebens. Sie probierte es erneut 2018, diesmal parallel auch beim Thomanerchor. Eigentlich habe sie erstmal nur eine Begründung haben wollen, denn sie sah die tatsächliche Aufnahme ohnehin als unrealistisch an.
Aus Berlin blieb ein Bescheid aus. Der Thomanerchor dagegen bezog sich in seinem Ablehnungsbescheid auf eine gewohnheitsrechtliche Diskriminierungsbefugnis. Nach einigem Hin und Her mit der UdK – der Dekan der Fakultät Musik hatte zwischenzeitlich geäußert «Niemals kann ein Mädchen in einem Knabenchor mitsingen» – lud der Staats- und Domchor das Mädchen schließlich zu einem Kennenlernen und Vorsingen im März 2019 ein. Parallel dazu reichte die Mutter Klage beim Verwaltungsgericht Berlin ein, um zu erwirken, dass der Staats- und Domchor Mädchen nicht generell wegen ihres Geschlechts ablehnen dürfe.
Diskriminierungs- oder Kunstfreiheit? Grundrechte im Konflikt
Im August erging das Urteil, das Bräckleins Klage abwies. Der Chorleiter habe für das Gericht glaubhaft erklärt, dass für ihn das Geschlecht keine Rolle spiele und er das Mädchen aufgenommen hätte, wenn es zum von ihm angestrebten Chorklang gepasst hätte – eine Ablehnung aus künstlerischen Gründen. Mädchen allein wegen ihres Geschlechts auszuschließen oder den Ausschluss mit der männlichen Tradition zu begründen, genüge aber nicht, so das Gericht. Es sei zwar für das Gericht naheliegend, dass das Aufnahmekriterium «Knabenchorklang» eher zur Aufnahme von Jungen als von Mädchen führe. Dies sei aber nur eine mittelbare Ungleichbehandlung. Offen blieb, wie der Konflikt der Grundrechte Diskriminierungsfreiheit (Artikel 3, Absatz 3 im Grundgesetz) und Freiheit der Kunst (Artikel 5, Absatz 3 ebendort) aufzulösen sei. Hierfür ließ das Gericht die Berufung zu. Das Verfahren ist also noch nicht abgeschlossen. Deshalb äußert sich die UdK derzeit nicht dazu.
Die Klägerin zeigt sich mit dem Urteil ganz zufrieden, auch wenn sie die Erklärung des Chorleiters für ein reines Lippenbekenntnis hält: «In drei von vier Punkten hat das Gericht meine Rechtsauffassung vollumfänglich geteilt. Der Thomanerchor hat im Anschluss an das Urteil freiwillig seine Formalposition traditionell-biologischer Exklusivität geräumt und ein Mädchen eingeladen. Das ist doch ein großer Erfolg. Die Tür ist auf. Durchgehen müssen dann andere», sagt sie.
«Welchen Teil des Wortes Knabenchor hat diese Helikoptermutter nicht verstanden?» – «Genderwahn bedroht Kulturerbe» so und ähnlich lauteten Reaktionen auf den Fall in den sozialen Medien und in der Lokalpresse. Auch in den Kommentarspalten der überregionalen Feuilletons diskutierte man den Fall. Offenbar hatte er einen Nerv getroffen. Doch eigentlich geht es um die Frage der Chancengleichheit für Jungen und Mädchen. Die Klägerin begründete ihr Vorgehen ja mit der Formel «Kommen Ressourcen nicht zu Mädchen oder zu Mädchenchören, müssen Mädchen zu den Ressourcen kommen.»
Wie stehen Knaben- und Mädchenchöre finanziell wirklich da?
Dass es in Deutschland zahlreiche Knabenchöre in öffentlicher Trägerschaft gibt, in denen Jungen eine intensive musikalische Ausbildung auf höchstem Niveau erhalten, sieht die Klägerin im Widerspruch zum Gleichbehandlungsgrundsatz, da vergleichbare Institutionen nicht für Mädchen existierten. Die Frage, wie es sich denn nun tatsächlich mit dem Klangunterschied zwischen Knaben- und Mädchenstimmen verhalte und ob es musikalisch und pädagogisch sinnvoll sei, Knabenchöre auch für Sängerinnen zu öffnen, das wurde ausführlich diskutiert. Die Chorzeit wird dieser Fragestellung in einer der nächsten Ausgaben einen eigenen Artikel widmen. Was bislang weniger transparent ist: Wie stehen die Knaben- und Mädchenchöre im Land wirklich finanziell da – mit welchen Ressourcen, unter welchen Bedingungen arbeiten sie und was kostet das die jungen SängerInnen beziehungsweise deren Eltern?
Um das in Erfahrung zu bringen, startete die Chorzeit eine Umfrage unter mehr als 50 Knaben- und Mädchenchören. Ein Drittel davon beantwortete unseren Fragenkatalog. Das ergibt zwar kein repräsentatives Bild, aber bestimmte Tendenzen lassen sich ablesen. Wichtig vorwegzuschicken ist jedenfalls: Die Kulturausgaben der Kommunen und Länder rangieren überall weit unten in den Haushaltsplänen. Insofern soll es hier nicht darum gehen, eine Neiddebatte zu entfachen, denn alle haben vergleichsweise wenig und es ist leider nicht unüblich, dass im Musikbereich Tätige einen Teil ihrer Arbeit unbezahlt machen.
Was jedenfalls nicht ganz stimmt, ist dass die 250 Knaben und über 75 jungen Männer der elf unterschiedlichen Chorgruppen des Berliner Staats- und Domchors (SDC) eine kostenlose Ausbildung genießen. Der Chor an der UdK, die vom Land Berlin und vom Bund den Großteil ihrer Mittel erhält, erhebt zwar keine festen Mitgliedsbeiträge. Jedoch, so eine Mutter mit zwei Söhnen im SDC, wird den Eltern zu Beginn jedes Schuljahres nahegelegt, einen freiwilligen Beitrag zu zahlen – je nach Chorgruppe und entsprechender Probendichte eine bestimmte Summe. Schließlich probt der Konzertchor dreimal wöchentlich und jeder Sänger erhält Stimmbildung.
Eine intensive musikalische Ausbildung, in der Kinder aufeinander aufbauende Chorgruppen durchlaufen, im Konzertchor schließlich mehrmals die Woche proben, dazu regelmäßig einzeln oder in Kleingruppen Stimmbildung erhalten, ein breites Auftrittspensum absolvieren und dabei viel Chorliteratur kennenlernen – das gibt es vor allem bei den kirchlich getragenen Chören kostenlos, so etwa bei den Essener und den Würzburger Domsingknaben, dem Mädchenchor am Essener Dom und der Mädchenkantorei am Würzburger Dom (katholisch), aber auch beim ökumenischen Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart (freie Trägerschaft). Unter den Chören, die sich bei uns zurückmeldeten, war der Stadtsingechor Halle, ein Knabenchor mit über 900 Jahre alter Tradition, der einzige Chor in öffentlicher Trägerschaft, dessen Mitglieder keine Beiträge zahlen müssen.
Die anderen beiden mitteldeutschen Aushängeschilder, der Dresdner Kreuzchor und der Leipziger Thomanerchor, sind ebenfalls vollständig städtisch getragene Ensembles. Wer einen Sohn im Thomanerchor und im dazugehörigen Internat hat, muss monatlich 140 Euro zahlen. Deutlich größeres finanzielles Engagement fordert der in derselben Liga spielende Windsbacher Knabenchor, eine juristisch eigenständige Einrichtung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und ebenfalls ein Internatschor. Hier zahlt man monatlich bis zu 765 Euro.
Versuch, in Windsbach einen Mädchenchor zu etablieren
In Windsbach sei übrigens vor zwölf Jahren der Versuch gescheitert, neben dem Knabenchor einen Mädchenchor zu etablieren, berichtete Domradio.de Anfang des Jahres. Im Windsbacher Internat hätten sich damals zu wenige Mädchen angemeldet und damit seien zu wenige bereit gewesen, sich auf die für den Knabenchor geschaffenen Bedingungen einzulassen. Seit den 1970er Jahren bis in die Nullerjahre hinein gründeten die meisten großen katholischen Knabenchöre eigene Mädchenchöre.
Am Aachener, Essener und Würzburger Dom etwa oder am Freiburger Münster liegen angestammter Knabenchor und relativ junger Mädchenchor jeweils in puncto Arbeitsbedingungen gleichauf. Doch was die öffentliche Wahrnehmung betrifft, ergeben sich noch immer Unterschiede: Der Knabenchor ist etabliert und in kirchen(musik)fernen Publikumsschichten hat es sich mitunter auch nach Jahrzehnten nicht herumgesprochen, dass ihm ein ebenbürtiger Mädchenchor zur Seite steht. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass Knabenchöre mit ihrer Stimmbesetzung die großen Oratorienwerke aufführen können, während Mädchenchöre eher weniger bekannte Literatur zu Gehör bringen, die wiederum nicht das ganz breite Publikum anzieht. Um auch mal eine h‑Moll-Messe aufzuführen, müssen sich Mädchenchöre Männerstimmen leihen – und dies wiederum braucht Kooperationsbereitschaft anderer Chöre und entsprechende Probenlogistik. Dennoch machen auch Mädchenchöre bei Wettbewerben regelmäßig mit Bestplatzierungen auf sich aufmerksam, so zum Beispiel die Mädchenchöre am Essener und am Kölner Dom, während die jeweiligen Knabenchöre eher selten solche Bühnen betreten.
Wo singen die meisten mit? Wie hoch ist die Ablehnungsquote?
In welchem Chor singen die meisten Kinder und Jugendlichen? Die Antworten, die uns erreichten, weisen den Knabenchor Hannover als Spitzenreiter aus: Hier singen etwa 240 Sänger – etwa 30 kommen jedes Jahr neu in den Chor. Es folgt der Berliner Mädchenchor, in dem derzeit 208 Mädchen und junge Frauen singen. In puncto Neuzugänge ist diese 1986 gegründete Chorschule Spitzenreiter: 65 neue Sängerinnen wurden in diesem Jahr aufgenommen, darüber hinaus gibt es eine Warteliste. Je 200 SängerInnen singen aktuell beim Hamburger Mädchenchor und beim collegium iuvenum Stuttgart. Dagegen nimmt sich etwa der Thomanerchor mit seinen aktuell 93 Sängern, von denen elf in der Mutationspause sind, ziemlich exklusiv aus. Im Windsbacher Knabenchor singen mit 128 Jungen wesentlich mehr, und das, obwohl hier mehr als die Hälfte aller Vorsingenden die Aufnahmeprüfung nicht bestehen.
Damit hat der Chor die höchste Ablehnungsquote unserer Umfrage. Beim Thomanerchor schaffen es etwa 30 Prozent der Aspiranten nicht, in den Chor aufgenommen zu werden, bei den anderen Chören meist höchstens 20 Prozent, einige gaben auch an, dass niemand abgelehnt werde.
Welcher Chor bestreitet wie viele Auftritte?
Die Landschaft deutscher Knaben- und Mädchenchöre ist durchaus komplex. Auf welchem Niveau die pädagogische und künstlerische Arbeit stattfinden kann, hängt natürlich einerseits von der Qualifikation der Chorleitung ab. Hieran mangelt es aber eigentlich nie. Entscheidender ist das Zeitbudget, dass die Chorleitung zur Verfügung hat, außerdem die Frage, ob auch Ressourcen vorhanden sind, um Assistenzkräfte und StimmbildnerInnen zu bezahlen, ob Raummiete anfällt, ob es ein professionelles Management gibt – oder stattdessen das künstlerische Personal oder Ehrenamtliche Organisationsaufgaben übernehmen müssen. Genau hier tun sich die Unterschiede auf.
So etwa leitet Gesa Wehrhahn, Studienrätin an einem Musikgymnasium, den Jugend- und den Konzertchor des Mädchenchors Hamburg unter dem Dach der Staatlichen Jugendmusikschule Hamburg mit einer Teilzeitstelle. Das beinhaltet vier Proben wöchentlich – für etwa 40 Konzerte im Jahr. Alle vier Jahre qualifiziert sich der Chor zudem für den Deutschen Chorwettbewerb. Ebenso viele Konzerte gibt der Windsbacher Knabenchor, bei dem noch liturgische Dienste hinzukommen. Nur der Thomanerchor liegt mit 50 Motetten, 25 Gottesdiensten und 30 Konzerten noch darüber.
2,5 Millionen Euro umfasst übrigens das Jahresbudget inklusive Internatsbetrieb der Thomaner, die rein rechtlich ein kommunales Unternehmen der Stadt Leipzig sind. Der Chor beschäftigt etwa 50 Menschen in Voll- und Teilzeit. Mit 250.000 Euro, also zehn Prozent davon, ebenfalls überwiegend aus öffentlichen Mitteln, wirtschaftet die Schola Cantorum. Unter ihrem Dach befindet sich der etwa 60-köpfige Mädchenchor der Stadt Leipzig und insgesamt etwa 300 SängerInnen in sieben Gruppen. 20.000 Euro generiert die Schola zusätzlich aus Spenden und durch den Förderverein. Sie beschäftigt fünf Angestellte in Voll- und Teilzeit, dazu 21 Honorarkräfte.
160.000 Euro beträgt das Jahresbudget des Berliner Mädchenchors (Träger: öffentliche Musikschule City West), ebenfalls regelmäßig auf den vorderen Plätzen beim Deutschen Chorwettbewerb. Die Hälfte davon ist Förderung der öffentlichen Hand. Alle sieben bis acht künstlerisch-pädagogischen Mitarbeiterinnen sind auf Honorarbasis beschäftigt, das Management übernehmen zwei Ehrenamtliche mit zusammen 30 Stunden in der Woche. Der Knabenchor Hannover erhält 60.000 Euro öffentliche Förderung im Jahr, generiert aber den Großteil des zehn mal so hohen Jahresbudgets über Einnahmen seiner 40 Konzerte im Jahr, über Spenden, eine eigene Stiftung, den Förderverein und Mitgliedsbeiträge bis zu 60 Euro im Monat. Nur fünf Prozent ihres Budgets bekommen die Chorknaben Uetersen, die regelmäßig mit besonderen Projekten und CD-Produktionen auf sich aufmerksam machen, aus öffentlicher Zuwendung. 95 Prozent kommen über Mitgliedsbeiträge (41 Euro monatlich), Konzerteinnahmen und private Sponsoren zusammen.
Deutsche Orchestervereinigung: Ungleichheit beseitigen
Fazit: Unterm Dach der katholischen Kirche arbeiten Knaben- und Mädchenchöre unter relativ soliden, gleichberechtigten Bedingungen. Bei Chören in öffentlicher Trägerschaft klafft eine große Lücke zwischen den gut ausgestatteten, Jahrhunderte alten traditionellen Knabenchören und Mädchenchören, die mit deutlich weniger Mitteln dennoch Erstaunliches leisten. Freie Chöre müssen bei sehr überschaubarer öffentlicher Förderung kreativ andere Finanzierungsquellen anzapfen.
Gerald Mertens, Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung, die auch die Rundfunkchöre vertritt, weist darauf hin, dass Knaben aus Traditionschören durch die umfassende Ausbildung im Musikinternat zudem deutlich im Vorteil sind beim Weg an die Musikhochschule und schließlich in die professionelle Laufbahn. Diese Knaben genössen zudem durch die Tradition, den Ruf und die finanzielle Ausstattung ihres Chores das Privileg den allermeisten Mädchenchören gegenüber, mit besonders renommierten KünstlerInnen und Klangkörpern an prestigeträchtigen Auftrittsorten zusammenzuarbeiten. Daher äußert Mertens im Namen seines Verbands die Auffassung, «dass öffentlich geförderte Knabenchöre, die eine umfassende institutionelle Ausbildung anbieten, durch die öffentliche Hand zu verpflichten sind, entsprechend gleichwertige Ausbildungsangebote auch an Personen des anderen Geschlechts zu unterbreiten». Natürlich müssten dann auch die entsprechend notwendigen Mittel bereitgestellt werden und in jeder Stadt wird dafür eine individuelle Lösung nötig sein, die die Chancengleichheit von Jungen und Mädchen garantiert.